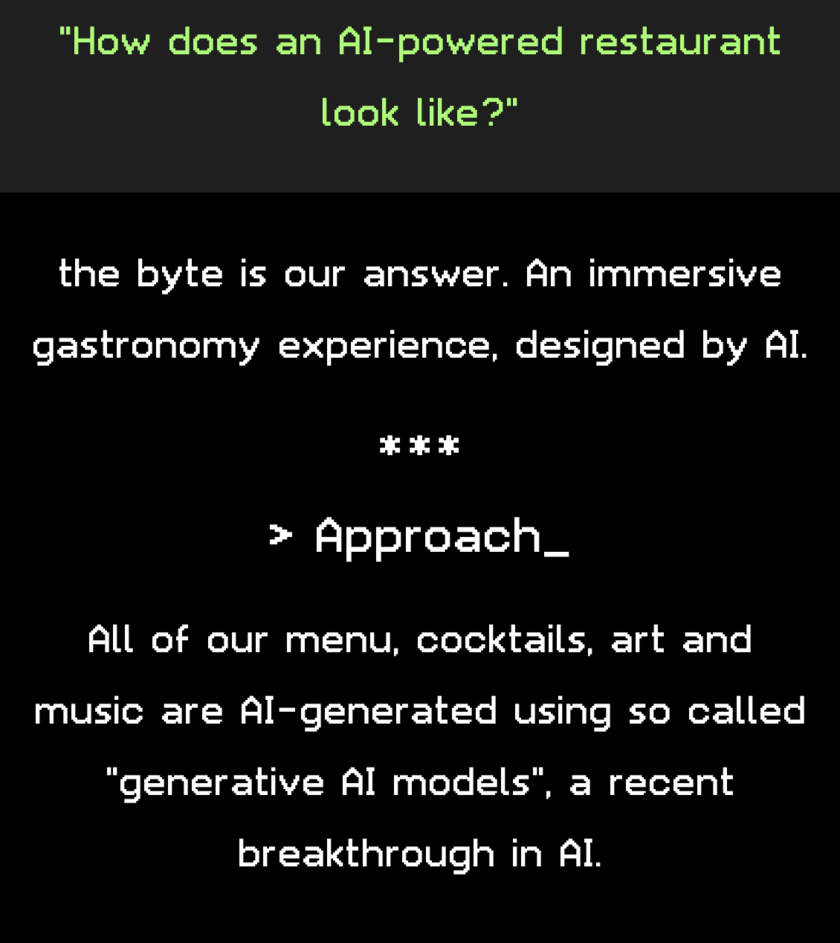Barbara Schellhammer ist Professorin für Intercultural Social Transformation an der Hochschule für Philosophie München. Dort ist die 45-Jährige seit 2019 auch Leiterin des Zentrums für Globale Fragen. Für ihren Forschungsschwerpunkt der Inuit-Kultur lebt und arbeitet sie zeitweise in Kanada.
Auszug aus unserer „elevatrEdition 3 – Creators“, Artikelveröffentlichung Dezember 2022
Barbara Schellhammer, Sie sind Kulturphilosophin und haben mit den Inuit in Kanada gelebt. Welche Erkenntnisse haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Barbara Schellhammer: Eindrücklich war zu sehen, in welchen Gegenden Menschen leben können. Die Natur, die eisige Kälte, die Dunkelheit, die Isolation. Das hatte eine gewisse Brutalität, aber auch Schönheit. Zudem die Erkenntnis, welche Bedeutung die Kultur für die Menschen hat und wie verheerend es ist, ihnen – wie im Fall der Inuit, die in Kanada jahrzehntelang kolonialisiert und assimiliert wurden – ihre Kultur zu nehmen. Wie dadurch Symptome wie Gewalt, Alkoholismus und Suizid bedingt werden. Damit zusammenhängend auch die Erkenntnis davon, was Kultur ist. Nämlich der Grund und Boden, auf dem wir Leben gestalten, Orientierung und Sinn erfahren. Und dass das Verstehen einer Kultur, auch der eigenen, immer unabgeschlossen bleibt.
Wie erklären Sie als Philosophin den Begriff Kultur?
Der amerikanische Kulturanthropologe Clifford Geertz spricht von einem Bedeutungsgewebe, einem dynamischen Gefüge. Man kann sich Kultur vorstellen wie ein Mobile. Wenn sich ein Teil davon bewegt, bewegt sich alles. Es ist kein in sich abgeschlossenes System, sondern alles bedingt sich wechselseitig. Wir gestalten als einzelne Personen dieses Gewebe mit und werden zugleich davon geprägt. Es gibt Wechselwirkungen, aber auch ein mehr oder weniger an Abschottung.
Abschottung?
Ja. Gerade durch die Auseinandersetzung mit Fremdem bekommen und festigen wir unsere eigene Struktur. Diese verliert man nicht im Dialog, im Gegenteil: Das Profil kommt noch deutlicher heraus. Weil man sich abgrenzen und darstellen muss, das ist auch gut so. Interkulturalität bedeutet, noch mehr über die eigene Kultur zu lernen. Sich zu verändern, aber sich nicht zu verlieren.
„Interkulturalität bedeutet sich zu verändern, ohne sich zu verlieren. “
Wie gelingt Interkulturalität?
„Inter“ bedeutet „dazwischen“. Und das Wort „Integration“ schillert zwischen zwei Be griffen. Auf der einen Seite Assimilation, also Eingemeindung im negativen Sinne: nämlich dem Fremden sozusagen seinen Stachel zu nehmen und ihn uns möglichst ähnlich zu machen, damit es nicht mehr wehtut. Und Laissez-faire als anderes Extrem; keine Begegnung, die verändert, zuzulassen – dann bekämen wir aber ein Problem mit Parallelgesellschaften. Interkulturalität, wenn wir sie erfolgreich leben, braucht zudem die Selbstsorge. Das bedeutet, seine eigenen Bedürfnisse und Werte zu kennen, für sie Verantwortung zu übernehmen und einzustehen.
Was bedeutet das für gelungenes Onboarding in Unternehmen?
Der Begriff Onboarding schillert genau wie der Integrationsbegriff zwischen Assimilation und Gleichgültigkeit. Worum es konkret geht, ist Fremdheitsfähigkeit, das heißt dem eigenen Befremdet-Sein gut begegnen zu können. Sonst wird Verstehen zum Machtprinzip. Alles, was man versteht, erschreckt einen nicht mehr. Wenn man Fremdes in seine eigenen Systematiken einordnet, raubt man ihm seinen Stachel, man nimmt ihm seine Eigentlichkeit. Wer sich selbst, seine Werte und Bedürfnisse kennt, kann Fremdem angstfreier und gestaltend begegnen.
Wie kann ein Betrieb seine Mitarbeitenden darauf vorbereiten, dass „neue“ Kollegen aus anderen Kulturen ins Team kommen?
Es geht darum, Lernräume zu schaffen. In gemeinsamen Projekten die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit zu üben. Eine Gesprächskultur zu etablieren, die Räume schafft, in denen es möglich ist, über eine Situation oder ein Missverständnis auch auf der Metaebene zu sprechen. Nicht davon auszugehen: Das wird schon irgendwie gehen, sondern mit dem Be fremdet-Sein zu rechnen.
Bezieht sich dieses Befremdet-Sein auch auf eine Unternehmenskultur?
Selbstverständlich. Eine Gruppe von Menschen, die schon länger in einem Betrieb ist, entwickelt ganz automatisch ihre eigene Unternehmenskultur. Das kann man nicht künstlich herstellen. Es gibt Rituale – wo sitzt wer, wie begrüßt man sich? Diese sind für jemanden, der neu dazu kommt, natürlich erst einmal fremd. Er oder sie stolpert anfangs ein wenig im Bedeutungsgewebe herum. Aber mit der Zeit wächst die Person dort hinein und die Unternehmenskultur geht in Fleisch und Blut über. Gleichzeitig prägt die neue Person mit ihrer Individualität wieder das Gewebe.
Die Hospitality kann ein Zeichen setzen, wenn es um die Frage geht: Wer hat Priorität – der Fremde, der Gast oder der Feind?“
Sie leiten an der Hochschule für Philosophie in München auch das Zentrum für Globale Fragen. Mit welcher globalen Frage beschäftigen Sie sich aktuell intensiver?
Mit der Frage nach sozial-ökologischer Transformation. Wir arbeiten hierzu aktuell unter anderem an einem Projekt, das sich mit der Energiegewinnung aus Klärschlamm auseinandersetzt. Dabei interessieren uns besonders die Widerstände und Trägheitseffekte der Transformation, von deren Notwendigkeit wir doch eigentlich wissen.
Wir wissen also eigentlich alle, dass sich beispielsweise beim Thema Klimawandel etwas tun muss, sind aber trotz dem träge – warum?
Wenn es um sozial-ökologische Transformation geht, ist leider immer nur von sozial die Rede, nicht von kulturell. Ich halte das für fatal, denn Kultur gibt uns eine Erklärung für die Bremswirkung: Wir Menschen sind träge, weil Kultur ein Gewebe ist, das sich nicht wie eine Sozialstruktur von heute auf morgen ändern lässt. Daher tun sich Menschen auch in Unternehmen mit massiven Neuerungen schwer. Wir Menschen brauchen Zeit, damit unser Gewebe wachsen kann. Das dürfen wir nicht vernachlässigen.
Welche Haltung könnte uns im Transformationsprozess helfen?
Wir alle müssen neugierig sein und fragen: Worauf weisen Verhaltensweisen, die Menschen an den Tag legen, überhaupt hin? Nur so kommt man an die Wurzel. Und über die muss man dann sprechen. Das braucht Zeit, kostet Geld und benötigt Vertrauen.
Welchen Beitrag kann die Hospitality Branche zu Interkulturalität und Transformation leisten?
Gastfreundschaft ist extrem wichtig, um Fremdheitsfähigkeit zu erlernen. Im Lateinischen gibt es eine sprachliche Verwandtschaft zwischen den Vokabeln hostis und hospes, die beide sowohl für den Fremden, als auch für Gast und Gastgeber stehen. Darüber hinaus weitet sich der Begriff hostis aus und kann sogar Feind oder Gegner bedeuten. Die Frage ist, wer hat Priorität: Der Fremde, der Gast oder der Feind? Hier kann die Hospitality klar Stellung beziehen und Zeichen setzen. Sie kann einen riesigen Beitrag leisten mit all der Dynamik und der Kreativität, die durch die Auseinandersetzung mit dem Fremden entsteht.
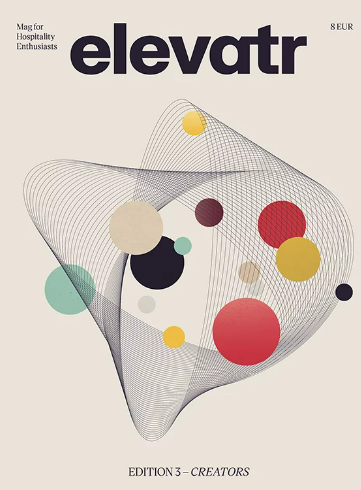
TOGETHER. WE. CREATE.
Unlock new #perspectives und entdecke neue Impulse zu Interkulturalität, Selbstsorge und sozialer Transformation.